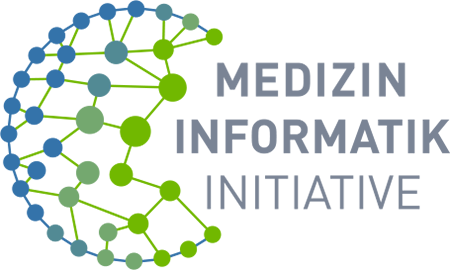Deutscher Minimalbasisdatensatz MBDS-SE.de
Vereinfacht dargestellt unterscheiden sich die Schwerpunkte der Maßnahmen zur Digitalsierung der Gesundheitssysteme in Frankreich und Deutschland, die in beiden Ländern durch Gesundheits-, Forschungs- und Wirtschaftsministerien staatlich gefordert und gefördert wird, hinsichtlich Pflicht und Freiwilligkeit der konkrete Inhalte. Während jenseits des Rheins die Digitalisierung durch die Vorgabe von definierten Datensätzen (Set de données), die dokumentiert werden müssen, geprägt ist, ist diesseits des Rheins überwiegend der Aufbereitung inklusive VerFHIRung der vorhandenen und aufkommenenden Daten die Priorität zugesprochen worden. Relevante Ausnahme von dieser Regel stellen im Bereich der Seltenen Erkrankungen die zum 1. April eingeführte gesetzliche Pflicht zur exakten Kodierung der stationär dokumentierten SE-Diagnosen gemäß § 301 SGB V und die Digitalisierung des "Gelben Heftes des Neugeborenen-Screenings" dar.
So besteht in Frankreich für die "centres de référence ou de compétences maladies rares" die Pflicht, für alle "patients", die von einer "maladie rare" betroffen sind, ein Set de données minimal des maladies rares (SDM-MR.fr) zu erheben. Das SDM-MR.fr enthält neben der Orpha-Kodierung der SE-Diagnosen auch die Beschreibung der Phänotypen durch HPO-Terms, die Benennung von Genetischen Diagnosen mittels der Nomenklaturen der Human Genome Variation Society (HGVS) beziehungsweise des Nomenklatur-Comités der Human Genome Organisation (HUGO / HGNC), eine knappe Familienanamnese und wenige ergänzende Angaben. Das Gesundheitsministerium in Paris präferiert und unterstützt die direkte Erhebung im "dossier patient informatisé" (Elektronische Patientenakte am klinischen Arbeitsplatz.
Eigentlich bestehen nur graduelle Unterschiede, da auch in Deutschland gemäß § 630f BGB eine gesetzliche Pflicht zur "Dokumentation der Behandlung" besteht, allerdings ohne semantische und ohne syntaktische Konkretisierungen:
(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, zum Zweck der Dokumentation in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch zu führen.
(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, insbesondere die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und Aufklärungen. Arztbriefe sind in die Patientenakte aufzunehmen.
Semantische und syntaktische Konkretisierungen mit Bezug zu SE erfolgen zwar durch den MII-KDS als Kompositum aus bereits vorhandenen Elementen der MII‐KDS‐Module DIAGNOSE (z.B. Orpha‐Kodierung der Diagnosen), SYMPTOM (z.B. HPO-Terms) und MOLEKURLARGENETISCHER BEFUNDBERICHT (z.B. HGVS und Familienanamnese).
Diese implizite Berücksichtigung der SE im MII-KDS stellt aber nur ein Regelwerk dar, wie "eh" vorhandene oder aufkommende Dokumentationsinhalte standardisierte werden sollen – die implizite Berücksichtigung als Kompositum stellt keine Dokumentationsaufforderung dar.
Auch die explizite Berücksichtigung eines Datenmodells für den MBDS‐SE.de (Minimalbasisdatensatz Seltene Erkrankungen) als Modul „Seltene Erkrankungen“ im MII-KDS stellt an sich noch keine Dokumentationsvorschrift oder -aufforderung dar. Sie kann aber für sich die dahingehende Überlegungen unterstützen.
Der vorliegende Vorschlag der bundesweiten expliziten Berücksichtigung (=Erhebung) des MBDS-SE.de in jeder Versorgungsdokumentation und in vielen Registern nach europäischem (CDS-ERDRI.eu) und nach französischen (SDM-MR.fr) Vorbild verbindet das Beste aus zwei Welten.
Der Vorschlag kann in Bezug auf Patientenakten im digitalen Kontext auch als forcierte Umsetzung des § 630f BGB interpretiert werden, indem die für die derzeitige und künftige Behandlung wesentliche Dokumentation der Orpha-Kodierung der Diagnosen und die standardisierte Geno- und Phänotypisierung in der Patientenakte realisiert wird.
Die in der Behandlungsdokumentation integrierten SE-Minimalbasisdatensätze sollen nicht nur lokal, sondern auch in datenschutzkonformer Weise gemeinsam übergreifend möglichst vielfältig genutzt werden können.
Darauf dürfen mit Orientierung an der Gliederung der Europäischen Referenznetzwerke für Seltene und Komplexe Erkrankungen (ERN) spezifischere, differenziertere Dokumentationen aufbauen.